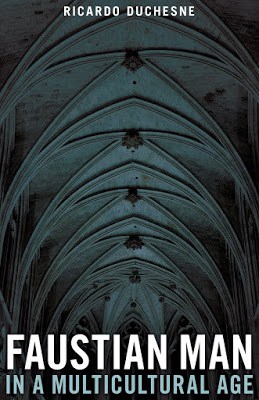Von Peter Frost, übersetzt von Lucifex. Das Original The Puzzle of European Hair, Eye, and Skin Color erschien am 11. Juli 2015 auf Evo and Proud und wurde am 7. August 2015 auf National Vanguard nachveröffentlicht.
DIE MEISTEN MENSCHEN haben schwarzes Haar, braune Augen und braune Haut. Europäer sind anders: ihr Haar ist auch braun, flachsblond, golden oder rot, ihre Augen auch blau, grau, haselnußbraun oder grün, und ihre Haut ist blaß, fast wie die eines Albinos. Dies ist besonders bei Nord- und Osteuropäern der Fall. (ILLUSTRATION: Mary Magdalene, Frederick Sandys [1829-1904]. Ist das physische Erscheinungsbild der Europäer allein oder auch nur hauptsächlich eine Anpassung an das Klima?)
Wie ist dieses Farbenschema zustande gekommen? Vielleicht wirken sich dieselben Gene, die die Hautpigmentierung aufhellen, auch auf die Haar- und Augenpigmentierung aus? Doch die Gene sind in jedem Fall verschiedene. Unsere Haut wurde hauptsächlich durch den Austausch eines Allels durch ein anderes auf drei verschiedenen Genen weiß. Unser Haar erwarb eine vielfältige Palette von Farben durch eine Ausbreitung neuer Allele auf einem anderen Gen. Unsere Augen erwarben eine ähnliche Palette durch ähnliche Veränderungen auf noch einem anderen Gen.
Dieses Farbschema ist in noch einer Weise rätselhaft: es ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Frauen sind in der Haarfarbe von Natur aus variabler als Männer, wobei insbesondere Rothaarige häufiger sind. Sie sind in denjenigen Populationen, wo blaue Augen häufig sind, gleichermaßen variabler in der Augenfarbe. Und schließlich sind Frauen überall auf der Welt hellhäutiger als Männer, als Ergebnis von Hautveränderungen in der Pubertät.
Während Frauen in ihren Haar- und Augenfarben vielfältiger sind, hat diese größere Vielfalt in jedem Fall eine verschiedene Ursache. Im Fall der Haarfarbe haben Frauen mehr von den Zwischentönungen, weil der dunkelste Farbton (schwarz) weniger leicht exprimiert wird. Im Fall der Augenfarbe haben Frauen mehr von den Zwischentönungen, weil der hellste Farbton (blau) weniger leicht exprimiert wird.
Falls die Haar- und Augenfarben sich auf Arten diversifizierten, die sich physiologisch unterscheiden, aber visuell ähnlich sind, dann muß der gemeinsame Zweck dieser Vielfalt visueller Art sein. Außerdem betrifft diese Vielfalt in beiden Fällen sichtbare Merkmale im Gesicht oder nahe dem Gesicht – dem Fokus der visuellen Aufmerksamkeit.
Sexuelle Selektion?
Warum würde ein Gesichtsmerkmal bei einem Geschlecht bunter werden als beim anderen? Der wahrscheinlichste Grund ist sexuelle Selektion, die stattfindet, wenn ein Geschlecht um die Aufmerksamkeit des anderen konkurrieren muß. Diese Art der Selektion begünstigt ins Auge springende Farben, die entweder hell oder neuartig sind.